 |
|
|
| Eine geleitete Schule |
|
|
|
|
|
|
|
Thema: Bildungsforschung & Bildungsreformen |
| Schulleitung: Aufstieg ins Reich der Widersprüche |
| Sich in einer Schulleitung engagieren, ist eine der raren Aufstiegsmöglichkeiten für Lehrerinnen und Lehrer. Der Job ist kein Honiglecken. Doch trotz hoher Belastung sind die meisten Leitungspersonen grundsätzlich zufrieden, wie eine Studie zeigt. |
|
|
"Wie kann man zufrieden sein, wenn die Zeit für Entwicklungsaufgaben und die Kompetenz im operativen Bereich fehlen?!" fragte und kommentierte zugleich Elisabeth Fröhlich, Verantwortliche für die Schulleitungs-Ausbildung im Kanton Bern. In der Tat finden sich zum Teil merkwürdige Befunde in der Studie «Schulleitungsrealität an Volksschulen der Deutschschweiz", welche die Hochschule für Wirtschaft Luzern (HSW) im Auftrag der Vereinigung Schulleitungsbeauftragte Schweiz (VSLCH) erstellt hat. Die Arbeit wurde an der Fachtagung des VSLCH vom 15. November in Hergiswil präsentiert.
Was die Autorinnen Sonia Dal Gobbo und Veronika Peyer-Siegrist bei ihrer Befragung von 74 Schulleitungsteams mit insgesamt 192 Personen erfuhren, zeigt in der Auswertung ein weites Feld von Widersprüchen:
Mehr als 50% der befragten Personen geben an, ihre Freizeit und ihr Familienleben würden unter der Leitungsfunktion leiden. Beinahe die Hälfte von ihnen sieht Nachteile für den eigenen Unterricht und mehr als ein Drittel fühlt sich wegen der Schulleitungsfunktion gar gesundheitlich gefährdet. Dennoch können 91% der Schulleitungspersonen sich mit ihrem Job identifizieren.
77% der Befragten glauben, dass ihr Schulleitungsteam bei der Führungsarbeit mit zu wenigen Stellenprozenten auskommen muss. 39% aber sind mit ihrem individuellen Leitungspensum zufrieden und 52% möchten es gar erhöhen. Der Missstand führt demnach nicht zu einem Mangel an Motivation.
Nur 8% der Schulleitungsteams sind mit einem Globalbudget ausgestattet, aber 93% wünschen sich eines. Rund 40% der Teams müssen in ihrem Management-Job auf die minimale Infrastruktur eines eigenen Büros, eines Telefons oder PCs verzichten. Nur 40% kennen den «Luxus" eines eigenen Besprechungsraumes. Dennoch halten satte 57% die vorhandene Infrastruktur für ausreichend.
Nur wenige Leitungsteams können mehr als 50% ihrer Zeit für Entwicklungsfragen an ihren Schulen einsetzen; die Mehrheit verliert den Löwenanteil ihrer (knappen) Zeit an administrative Routine. Auf das Wohlbefinden der Schulleitungen hat dies jedoch nur geringen Einfluss, wie die Autorinnen der Studie herausfanden.
Die
misslichen Bedingungen sind dabei nicht etwa einer noch unstabilen Pionierphase
zuzuschreiben: Vielmehr konzentrierte sich die Erhebung der Daten auf jene
Kantone, in denen die Schulleitung bereits als Institution verankert ist:
Bern, beide Basel, Luzern, Nidwalden, Obwalden und Zug.
| Trotz hoher Belastung unverdrossen |
Woran liegt es, dass ein grosser Teil der Schulleitungspersonen und -teams in misslichen Bedingungen unverdrossen ans Werk geht? Stefan Pfäffli, HWS-Dozent und Betreuer der Autorinnen, spricht von einer "hohen intrinsischen Motivation". "Intrinsisch" nennt die Psychologie «Verhaltensweisen, die aus reiner Funktionslust erfolgen" (Brockhaus). Das heisst: Die Schulleiterinnen und Schulleiter lieben ihren Job und sehen ihn als sinnvoll an; dafür nehmen sie auch zusätzliche Belastungen, ungenügende Infrastruktur und in vielen Fällen eine fast armselige Abgeltung ihrer Führungsleistung in Kauf.
Diese
Genügsamkeit mag für die einzelne Person gelten, für die
Vereinigung Schulleitungsbeauftragte Schweiz (VSL CH) gilt sie nicht. Wie
ihr Präsident Hans Jürg Grunder an der Hergiswiler Fachtagung
sagte, zeigt die Studie vor allem, dass keines der vorhandenen Leitungsmodelle
den Ansprüchen genügt. Insbesondere fordert der VSL eine verbesserte
und erweiterte Ausbildung, speziell in Personalführung, Weiterbildung
und Coaching für die Führungspersonen sowie einen national anerkannten
Ausbildungs-Standard. Eine Vorlage dazu liege seit längerem in einer
Schublade der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK). Der Vorstand des VSLCH
will dafür sorgen, dass diese Vorlage demnächst wieder ans Licht
der Bildungspolitik gelangt; LCH-Zentralpräsident Beat W. Zemp (vgl.
Kasten) sicherte umgehend seine Unterstützung dafür zu.
| Besoldung eines Chefbeamten |
Die Funktion der Schulleiterin und des Schulleiters an der Volksschule ist ein neuer Beruf und soll auch entsprechend besoldet werden, meinte Hans Jürg Grunder schliesslich. Er betonte, dass die Leitungsaufgaben auf allen Stufen gleich anspruchsvoll und deshalb gleich zu behandeln seien, vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe.
Dahin
scheint die Entwicklung denn auch zu gehen - jedenfalls wenn man eine Stellenausschreibung
aus dem Kanton Zürich als Zeichen nehmen will, in der es heisst: "Es
erwartet sie eine sehr interessante Stelle in der Besoldungsklasse eines
Chefbeamten der Gemeinde..." Tagungsteilnehmer aus der Zentralschweiz berichteten
von einer Art "Transfermarkt" für Leitungspersonen. Wer ein guter
Schulleiter sei, spreche sich rasch herum, und solche Leute brauchten auf
Stellenangebote nicht lange zu warten.
| Betriebswirtschaftliche Ratschläge |
Die ökonominnen der HSW geben den Schulleitungsbeauftragten am Schluss ihrer Studie einige Ratschläge mit auf den Weg:
Einen starken Akzent legen sie auf klare Regelung der Kompetenzen. Es sei unabdingbar, dass diese "schriftlich festgehalten und auch allen beteiligten Stellen kommuniziert werden". Die Umfrage hatte ergeben, dass geregelte Kompetenzen entscheidenden Einfluss auf die Zufriedenheit der Leitungsteams haben.
Dass ohne Kommunikation "nichts geht", ist inzwischen ein Allgemeinplatz. Weniger klar scheint, dass den Leitungspersonen dafür auch genügende zeitliche und technische Ressourcen zur Verfügung stehen müssen. "Wenn die Zeit fehlt und die Informationskanäle generell zu beschwerlich sind, werden als Folge von Kommunikationsdefiziten Entscheidungen mitunter schlecht nachvollziehbar", halten die Autorinnen fest. Die Erfahrung zeige, dass dadurch wichtige Entwicklungen blockiert werden könnten.
Die Mehrheit der Schulleitungspersonen ist, gemäss Studie, zeitlich zu hoch belastet. Dies müsse über kurz oder lang zu Qualitätseinbussen und Unzufriedenheit führen. Die Autorinnen halten die Ausübung eines gewissen Anteils Lehrtätigkeit für wichtig, um den Bezug zur Basis nicht zu verlieren. Sie raten dazu, Routinearbeiten an ein Sekretariat zu delegieren.
Die
Grösse der Leitungsteams sollte sich "in sinnvollen Proportionen
bewegen", meinen die Autorinnen. Die Studie hatte Leitungen von zwischen
einer und neun Personen erfasst, wobei die Einzelleitung oder das Zweierteam
die häufigsten Lösungen sind. Die Autorinnen nennen keine "ideale
Grösse" einer Schulleitung; sie warnen aber vor interner Gruppenbildung
bei grösseren Teams. Und sie sind ziemlich kompromisslos der Meinung,
dass Leitungspensen von 40% und darunter nicht weiter aufgeteilt werden
dürfen. Laut HSW-Dozent Stefan Pfäffli sind Pensen von weniger
als 25 Prozent "nicht sinnvoll, um in eine Aufgabe einzusteigen und betriebswirtschaftlich
fragwürdig".
| Schlüsselpersonen |
Erstes Fazit der Studie, die noch weiter auszuwerten sein wird: Die Institution Schulleitung steckt hierzulande noch voll in der Aufbauphase, wo viel gebastelt und und behelfsmässig organisiert wird. Das gilt offensichtlich auch für Kantone, die bereits eine gewisse Schulleitungstradition haben.
Für Ausbildnerin Elisabeth Fröhlich sind Schulleitungspersonen "die Change Manager im schwierigen Wandel vom System". Sie seien damit die Schlüsselstellen jeder Schulreform. Dies ist laut Fröhlich vor allem den Politikern bisher verborgen geblieben. - "Nicht nur ihnen", könnte man aus der HSW-Studie schliessen.
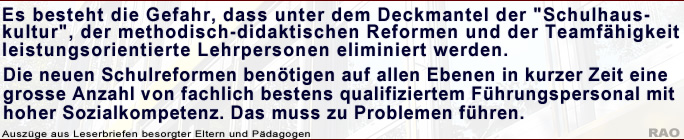
|