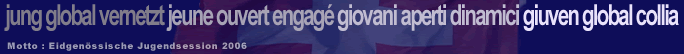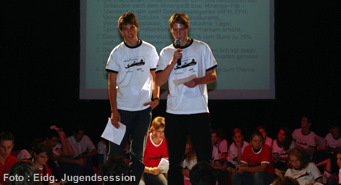|
Eidgenössische
Jugendsession |
 |
Schweizer Jugend Politik |
|
 |
Schweizer Jugend Politik |
|
|
Eidgenössische
Jugendsession |
 |
| Aktiv
in der Politik: Jugendparlamente (Foto: Jugendsession) |
| Geschichte
und Entwicklung der Jugendsession |
 |
1991
- Ursprung
1991
wurde die SAJV damit beauftragt, die Jugendsession im Rahmen der 700-Jahr-Feier
der Schweiz durchzuführen. Den Jugendlichen war das nicht genug -
1993 wurde die Jugendsession zum zweiten Mal durchgeführt, diesmal
aber auf Initiative von Jugendlichen hin. Die Jugendsession - angeregt
durch Herrn Nationalrat Roland Wiederkehr - war zurück.
1994
- Themen: Eine zielgerichtete Arbeitsweise ist möglich
Um
die Forderungen der Jugendlichen klarer formulieren und adressieren zu
können, einigten sich die Mitglieder des Organisationskomitees 1994
zum ersten Mal auf ein einheitliches Thema. Seitdem wurden Themen - jeweils
auf die aktuelle Schweizer Politik abgestimmt - wie zum Beispiel Europapolitik,
Solidarität, Sicherheitspolitik, und Demokratie, diskutiert.
1996
- Ausbau: Regionale Jugendsessionen erweitern das Publikum
1996
wurde das Konzept der Jugendsession ausgebaut. Um mehr Jugendliche zu erreichen
und die Idee der Jugendpartizipation auf politischer Ebene weiter zu tragen
wurden im Vorfeld der Eidgenössischen Jugendsession in Bern zum ersten
Mal Regionale Jugendsessionen in sechs Städten der Schweiz organisiert.
2001
- Reformen: Das Forum Jugendsession sorgt für Nachhaltigkeit
Jedes
Jahr konnten die Jugendlichen ihre Forderungen verfassen und an die zuständigen
Stellen weiterleiten. Viele der Vorstösse und Petitionen landeten
jedoch in einer Schublade der Bundesverwaltung; lange gab es kein Organ
innerhalb der Jugendsession, dass sich nach der Eidgenössischen Jugendsession
um die Forderungen kümmerte. Um dem abzuhelfen wurde nach rund einjähriger
Vorbereitungszeit im Mai 2001 das «Forum Jugendsession» als
drittes Organ neben der Regionalen- und der Eidgenössischen Jugendsession
ins Konzept aufgenommen.
| Politische
Themen |
 |
Jung:
Jugendarbeitslosigkeit
Im
Januar 2004 hat die Jugendarbeitslosenquote in der Schweiz ihren höchsten
Stand erreicht: 3.3% bei den 15-19-Jährigen, 7.2% bei den 20-25-Jährigen
und 5.6% bei den 25-29-Jährigen (SAH, 2004, 6) bei einem Total von
500'000 Jungen. Gemäss dem Schweizerischen Arbeiterhilfswerk (SAH)
finden die Jungen keine Arbeit, weil sie keine Berufserfahrung mit bringen,
weil die Unternehmen mangelndes Interesse an ihrer Ausbildung zeigen, sie
zu jung sind oder schlicht kein Vertrauen in die Jungen besteht, wenn sie
ihr Studium abgebrochen haben. Gleichzeitig verringern äussere Einflüsse
die Eingliederungschancen auf dem Arbeitsmarkt:
1) Der
Arbeitsmarkt selber: Konjunktur, Demografie, fehlende Lehrstellen.
2) Sozio-politische
Ursachen: Junge AusländerInnen und Jugendliche mit Migrationshintergrund
sind häufiger betroffen.
3) Ungleichgewicht
zwischen Ausbildung und Arbeit: Das Schweizerische Erziehungssystem
bereitet die Jungen nicht auf den Arbeitsmarkt vor.
4) Schwache
soziale Flexibilität: Die Schweiz ist eines der europäischen
Länder, in dem die soziale Flexibilität am schwächsten ist.
Das heisst, dass Jugendliche aus armen Familien oft das familiäre
Schema reproduzieren und nicht frei eine bestimmte Berufsausbildung wählen
können.
Daraus
zeichnen sich folgende Konsequenzen ab:
1) Individuelle
Konsequenzen: Verlust an Selbstvertrauen, Depressionen, soziale Abgrenzung.
2) Zunahme
unsicherer Arbeitsstellen: Die Jungen machen daher eine grosse Gruppe
der working poor in der Schweiz aus.
3) Ausbildung: Mit kleinen Jobs kommt man schneller zu Geld als mit einer Ausbildung.
Für Jugendliche ist daher nicht unbedingt lukrativ, eine Ausbildung
zu machen.
4) Höhere
soziale Kosten für die Gesellschaft: Die jungen Arbeitslosen sind
oft ein einer schlechteren psychischen und physischen Verfassung als ihre
arbeitenden AltergenossInnen. Das kann sich auch in Form einer Mehrbelastung
der IV (Invalidenversicherung) und Sozialhilfe auswirken.
5) Langzeitarmut: In vielen Fälle entwickelt sich daraus schliesslich eine Langzeitarmut.
| Weitere
Informationen |
 |
nach
oben
| Politische
Themen |
 |
Im
Januar 2004 hat die Jugendarbeitslosenquote in der Schweiz ihren höchsten
Stand erreicht: 3.3% bei den 15-19-Jährigen, 7.2% bei den 20-25-Jährigen
und 5.6% bei den 25-29-Jährigen (SAH, 2004, 6) bei einem Total von
500'000 Jungen. Gemäss dem Schweizerischen Arbeiterhilfswerk (SAH)
finden die Jungen keine Arbeit, weil sie keine Berufserfahrung mit bringen,
weil die Unternehmen mangelndes Interesse an ihrer Ausbildung zeigen, sie
zu jung sind oder schlicht kein Vertrauen in die Jungen besteht, wenn sie
ihr Studium abgebrochen haben. Gleichzeitig verringern äussere Einflüsse
die Eingliederungschancen auf dem Arbeitsmarkt:
1) Der
Arbeitsmarkt selber: Konjunktur, Demografie, fehlende Lehrstellen.
2) Sozio-politische
Ursachen: Junge AusländerInnen und Jugendliche mit Migrationshintergrund
sind häufiger betroffen.
3)
Ungleichgewicht zwischen Ausbildung und Arbeit: Das Schweizerische Erziehungssystem
bereitet die Jungen nicht auf den Arbeitsmarkt vor.
4) Schwache
soziale Flexibilität: Die Schweiz ist eines der europäischen
Länder, in dem die soziale Flexibilität am schwächsten ist.
Das heisst, dass Jugendliche aus armen Familien oft das familiäre
Schema reproduzieren und nicht frei eine bestimmte Berufsausbildung wählen
können. Daraus zeichnen sich folgende Konsequenzen ab: 1) Individuelle
Konsequenzen: Verlust an Selbstvertrauen, Depressionen, soziale Abgrenzung.
| Quelle:
Eidgenössische Jugendsession 2006 |
 |
nach
oben
| Weiterführende Informationen |
 |
| Links |
 |
 |
 |
Externe Links |
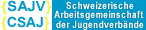 |
 |
 |
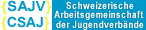 |
Jugendverbände
Staatskunde |
Staatskunde
Informationen |
Jugendbeteilung
Staatskunde |
Jugendbeteiligung
Staatskunde |
|