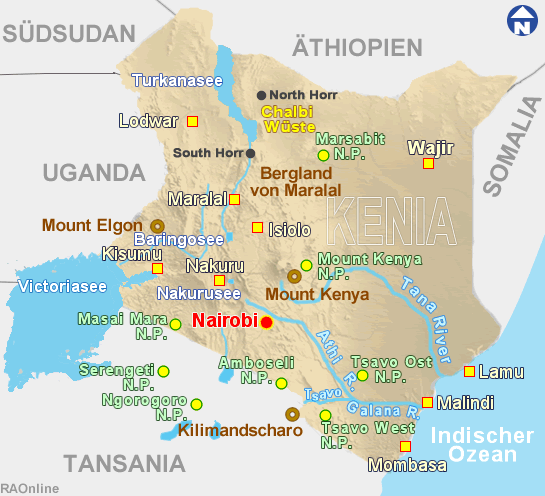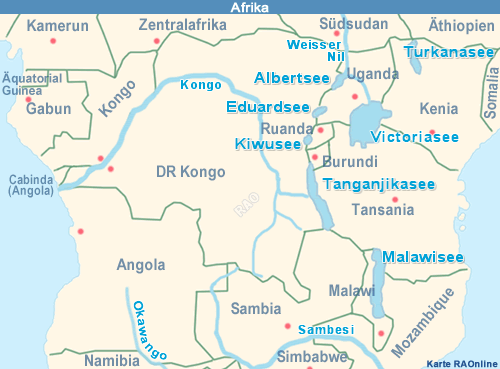|
Menschenaffen - Primaten Schimpansen |
|
 |
Menschenaffen - Primaten Informationen |
|
| Freundschaften zwischen Schimpansen basieren auf Vertrauen |
 |
Vertrauen und Freundschaft gehören nicht nur beim Menschen eng zusammen
Dass eine echte Freundschaft unter Menschen sich durch gegenseitiges Vertrauen auszeichnet, scheint uns selbstverständlich. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig haben jetzt herausgefunden, dass dies auch auf befreundete Schimpansen zutrifft. Auf Vertrauen basierende Freundschaften scheinen also im Laufe der Evolution sehr viel früher entstanden zu sein, als bisher angenommen, und sind kein Alleinstellungsmerkmal des Menschen.
Menschen vertrauen häufig nur ihren Freunden, wenn es um entscheidende Ressourcen oder wichtige Geheimnisse geht", sagt Jan Engelmann vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie. "In unserer Studie haben wir untersucht, ob Schimpansen vergleichbare Verhaltensmuster zeigen und gezielt den Artgenossen vertrauen, mit denen sie eine enge Bindung teilen. Unsere Ergebnisse zeigen, dass dies tatsächlich der Fall ist und dass die Merkmale, die wir menschlichen Freundschaften heute zuschreiben, eine lange evolutionäre Geschichte besitzen. Sie lassen sich auch auf die sozialen Bindungen anderer Primaten übertragen."
Frühere Studien zeigten bereits, dass Schimpansen Beziehungen miteinander haben, die Freundschaften ähneln, und zum Beispiel bevorzugt mit ausgewählten Artgenossen kooperieren. Die Frage, die sich stellte, war: Basieren diese Interaktionen auf Vertrauen? Um dies herauszufinden beobachteten Engelmann und Esther Herrmann über fünf Monate hinweg das Miteinander von 15 Schimpansen, die im "Sweetwaters Chimpanzee Sanctuary" in Kenia beheimatet sind. Basierend auf freundlichen Interaktionen, wie der gegenseitigen Fellpflege oder der gemeinsamen Nahrungsaufnahme,ordneten die Forscher jedem Schimpansen einen besten "Freund" und einen "Nicht-Freund" zu. |
 |
Dann nahmen die Schimpansen an einer abgewandelten Version des so genannten "Human Trust Game", einem Vertrauensspiel, teil. In dem Spiel haben Schimpansen die Wahl, an einem "Kein Vertrauen"-Seil oder an einem "Vertrauen"-Seil zu ziehen. Wählten sie das "Kein Vertrauen"-Seil, erhielt der am Seil ziehende Schimpanse sofortigen Zugriff auf ein nicht sonderlich beliebtes Nahrungsmittel. Zog er stattdessen am "Vertrauen"-Seil, erhielt sein Gegenüber ein besonders attraktives Futterstück und die Möglichkeit, dem Schimpansen, der am Seil gezogen hatte, etwas Leckeres zurückzuschicken (oder nicht). In anderen Worten: Das "Vertrauen"-Seil stellte ein Win-Win-Potenzial dar, jedoch nur wenn der erste Schimpanse ausreichend darauf vertraute, dass der zweite Schimpanse etwas zurückschicken würde.
Die Ergebnisse dieser experimentellen Interaktionen zwischen Schimpansen zeigten, dass sie Freunden sehr viel häufiger Vertrauen schenkten als nicht befreundeten Tieren. Die Forscher erklären es wie folgt: "Schimpansen waren sehr viel eher bereit, ihrem Gegenüber freiwillig Ressourcen zu überlassen - also die riskantere, doch potenziell ertragreichere Option zu wählen - wenn es sich bei ihr oder ihm um einen Freund handelte."
Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die menschliche Freundschaft nicht so einzigartig ist, wie bisher angenommen. "Freundschaften beim Menschen sind keine Anomalie im Tierreich", sagt Engelmann. "Andere Tiere, wie Schimpansen, gehen mit ausgewählten Individuen enge und langfristige Bindungen ein. Diese Tierfreundschaften weisen wichtige Parallelen zu engen Beziehungen zwischen Menschen auf. Ein gemeinsames Merkmal ist das Vertrauen, das Freunden in wichtigen Situationen gezielt entgegengebracht wird."
Engelmann und Herrmann planen, die Ähnlichkeiten zwischen den engen Beziehungen der Menschen und der Schimpansen weiter zu erforschen. Dazu gehört auch die Frage, ob Schimpansen ihren Freunden eher Hilfe leisten als nicht befreundeten Artgenossen.
Originalpublikation
Jan Maxim Engelmann und Esther Herrmann
Chimpanzees Trust Their Friends
Current Biology, 14 January 2016, (DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2015.11.037)
 |
| Quelle: Text SJ, JE/HR, Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie , Januar 2016 |
nach
oben
| Freundschaft geht durch den Magen |
 |
Schimpansen, die ihre Nahrung mit anderen teilen, haben mehr Oxytocin-Hormon im Urin
Soziale Beziehungen tragen massgeblich zum biologischen Erfolg des Menschen bei. Über ihre Entstehung und die ihnen zugrunde liegenden Mechanismen ist jedoch wenig bekannt. Das Hormon Oxytocin spielt dabei aber eine Schlüsselrolle. Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig haben die Oxytocin-Werte im Urin frei lebender Schimpansen gemessen.
Die Hormonkonzentration ist nach dem Teilen von Nahrung bei Spender und Empfänger höher als nach einer Nahrungsaufnahme in Gesellschaft, bei der nicht geteilt wurde. Der Oxytocinspiegel war sogar höher als nach der gegenseitigen Fellpflege, was darauf hindeutet, dass das Teilen von Nahrung für den Auf- und Ausbau sozialer Beziehungen sogar noch wichtiger sein könnte. Den Forschern zufolge sind beim Futterteilen möglicherweise dieselben neurobiologischen Mechanismen beteiligt, die die Mutter-Kind-Bindung während des Stillens bilden und fördern. Nahrung mit anderen zu teilen könnte also kooperative Beziehungen unter nicht miteinander verwandten erwachsenen Schimpansen sogar erst auslösen.
Menschen und einige andere Säugetiere bauen zu nicht verwandten Erwachsenen kooperative Beziehungen auf, die mehrere Monate oder Jahre dauern können. Aktuellen Studien zufolge ist daran das Hormon Oxytocin beteiligt, das die Mutter-Kind-Bindung herstellt und aufrechterhält. So steigt bei Schimpansen nach der gegenseitigen Fellpflege zwischen Kooperationspartnern der Oxytocinspiegel, egal ob diese miteinander verwandt sind oder nicht.
Um herauszufinden, ob es zwischen dem Teilen von Futter und der Ausschüttung des Hormons Oxytocin bei unseren nächsten Verwandten einen Zusammenhang gibt, haben Roman Wittig und seine Kollegen vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie 79 Urinproben von 26 frei lebenden Schimpansen aus dem Budongo Forest in Uganda gesammelt und analysiert. Die Forscher fingen die Proben innerhalb der ersten Stunde nach dem beobachteten Verhalten (Futter teilen oder Futter essen ohne zu teilen) auf, denn nur innerhalb dieses Zeitfensters ist das Oxytocin im Urin nachweisbar.
Das Ergebnis:
Der Oxytocinspiegel im Urin von Schimpansen, die mit anderen Gruppenmitgliedern Futter geteilt hatten, war wesentlich höher als bei denen, die, obwohl in Gesellschaft, Essen nicht teilten. "Dabei spielte es keine Rolle, wer Futter gegeben und empfangen hat oder ob die Tiere miteinander verwandt waren oder nicht. Auch ob sie Kooperationspartner waren oder nicht oder ob sie Fleisch oder anderes Futter miteinander teilten, hatte keinen Einfluss auf die Oxytocinwerte", sagt Wittig.
Darüber hinaus stellten die Forscher fest, dass der Oxytocinspiegel nach dem Teilen von Nahrung sogar noch höher war als nach der gegenseitigen Fellpflege, einem häufigen kooperativen Verhalten unter Schimpansen. Das könnte bedeuten, dass das Teilen von Futter einen noch stärkeren positiven Effekt auf den Aufbau und Erhalt von sozialen Bindungen hat als die Fellpflege. "Futter mit anderen zu teilen könnte ein Schlüsselverhalten für den Aufbau sozialer Beziehungen unter Schimpansen sein", sagt Wittig. "Da es für Spender und Empfänger gleichermassen von Vorteil ist, ist dieses Verhalten möglicherweise sogar ein Auslöser oder ein Anzeichen für den Beginn einer kooperativen Beziehung."
Die Forscher vermuten, dass das Teilen von Nahrung möglicherweiseneurobiologische Mechanismen aktiviert, die ursprünglich der Festigung der Mutter-Kind-Bindung während des Stillens dienten. "Zunächst entstand dieser Mechanismus, um die Mutter-Kind-Bindung über das Abstillen hinaus zu festigen", sagt Wittig. "Die Funktion, kooperative Beziehungen zwischen nicht miteinander verwandten Individuen aufzubauen und zu erhalten, könnte dann später hinzugekommen sein."
Die lateinischen Wurzeln des Wortes Kumpan ("com=mit", "panis=Brot") deuten unter Umständen auf einen ähnlichen Mechanismus beim Aufbau von Freundschaften beim Menschen hin. Ob der Oxytocinspiegel beim Menschen nach dem Teilen einer Mahlzeit tatsächlich höher ausfällt als beim "alleine Essen", wird Gegenstand zukünftiger Studien sein.
Originalpublikation
Roman M. Wittig, Catherine Crockford, Tobias Deschner, Kevin E. Langergraber, Toni E. Ziegler and Klaus Zuberbühler
Food sharing is linked to urinary oxytocin levels and bonding in related and unrelated wild chimpanzees
Proceedings of the Royal Society B, 15 January 2014, DOI: http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2013.3096
 |
| Quelle: Text SJ, RW/HR, Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie , Januar 2016 |
nach
oben
| Weitere Informationen |
 |
| Links |
 |
 |
 |
Externe Links |
|
Internationale
Organisationen bedienen sich vor allem der englischen Sprache. Auf für
Nichtenglischsprechende bieten diese Webseiten eine Fülle von Bildinformationen.
| Informationen
in englischer Sprache |
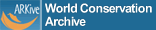 |
Nature
and Natural Resources
ARKive |
|
 |
|