| Armut in der Schweiz |
|
|
|
|
|
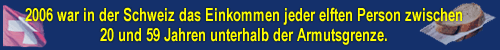 |
| Städteinitiative Sozialpolitik: Sozialhilfe 2008 |
| Soziale Sicherung an der heutigen Realität ausrichten |
Die Sozialhilfe gehört seit Jahrzehnten zu den klassischen Aufgaben der Städte und Gemeinden. Auch wenn sie immer wieder zu Diskussionen Anlass gibt: Ich kann mir für manche Menschen in ganz bestimmten Lebenslagen kein sinnvolleres soziales Netz denken. Denn die Sozialhilfe sichert nicht nur die materielle Existenz; die Sozialdienste der Städte stehen den anspruchsberechtigten Familien mit Kindern und Jugendlichen, den vielen Alleinerziehenden und Alleinstehenden auch für persönliche Beratung offen und bieten in den letzten Jahren vermehrt Programme zur beruflichen und sozialen Integration an. Darüber hinaus haben die Städte Angebote aufgebaut, die nicht im engeren Sinn Aufgabe der Sozialhilfe sind:
Kinderbetreuung,
Förderungs- und Unterstützungsprojekte für sozial benachteiligte
Familien - um nur einige zu nennen. Die Städte erreichen mit solchen
Investitionen einen gesellschaftlichen Nutzen, der viel zu wenig zur Kenntnis
genommen wird. Die sozialpolitischen Verdienste der Sozialhilfe sind halt
weniger augenfällig als die Kosten.
Apropos
Kosten: Ein Blick auf die jüngst prognostizierten roten Finanzzahlen
der öffentlichen Hände lässt einen Schluss zu: Die Kostenfrage
wird sich bei allen Aufgaben, auch jenen der sozialen Sicherung, künftig
noch schärfer stellen. Es dürfte in den kommenden Jahren noch
schwieriger werden, den heutigen Standard zu halten.
| Aktueller Bericht als Momentaufnahme - und schon überholt |
Der aktuellste Bericht zur Sozialhilfe 2008, aus dem Ihnen Ernst Schedler soeben ausgewählte Erkenntnisse erläutert hat, ist nur eine Momentaufnahme. So ist die gute Nachricht - Rückgang der Fallzahlen im letzten Jahr - gemäss den jüngsten Zahlen in manchen Städten bereits überholt: Die aktuelle Krise macht sich in der Sozialhilfe bemerkbar, wie das auch bei früheren Wirtschaftsabschwüngen war. Aber nicht nur: Die Sozialhilfe ist von verschiedenen externen Faktoren stark beeinflusst, unter anderem von den Leistungen der Sozialversicherungen. Zehn Jahre Kennzahlenvergleich
Der Kennzahlenvergleich zur Sozialhilfe in Schweizer Städten verhilft den Städten zu Erkenntnissen, beispielsweise über Fallzahlen und Fallstrukturen, und bildet besondere Herausforderungen deutlich ab. Die Kennzahlen wurden im Lauf der Jahre verfeinert und erscheinen nun zum zehnten Mal.
Die Städteinitiative Sozialpolitik hat dies zum Anlass genommen, gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen in diesem Zeitraum etwas ausführlicher zu beleuchten und nach Armutsrisiken zu fragen. Dazu liegt die druckfrische Publikation "Im Spiegel des Arbeitsmarktes: Armut und Sozialhilfe in Schweizer Städten" vor, verfasst von der Historikerin Dr. Frauke Sassnick Spohn. Weil die Sozialhilfe vorwiegend Personen im Erwerbsalter - und ihre Kinder - unterstützt, steht die Schnittstelle zum Arbeitsmarkt im Vordergrund. Seine Aufnahmefähigkeit beeinflusst die Sozialhilfe stark.
Auffangnetz für Langzeitarbeitslose
Ich greife einige Feststellungen aus dieser Publikation heraus: Nicht erst in den letzten zehn Jahren, schon seit längerem steigen mit dem Strukturwandel in der Wirtschaft die Ansprüche an die Beschäftigten stetig an. Einfache Arbeitsplätze sind verlorengegangen. Wer nun in unterschiedlichen Bereichen - Ausbildung, körperliche und psychische Gesundheit, persönliche und soziale Kompetenzen - grössere oder kleinere Defizite aufweist, hat auf dem Arbeitsmarkt zunehmend schlechtere Chancen. Diesen Trend spürt die Sozialhilfe der Städte deutlich: Hier finden sich viele ursprünglich Erwerbsfähige, die von der ALV ausgesteuert und langzeitarbeitslos sind.
Oft gerade als Folge dieser Langzeitarbeitslosigkeit weisen diese Personen mehrfache Erschwernisse für eine berufliche Reintegration aus. Sind sie dazu noch gering qualifiziert, haben viele gar keine Chancen mehr auf eine Anstellung und bleiben oft über Jahre in der Sozialhilfe. Dieser Trend ist auch bei gutem Gang der Wirtschaft kaum umkehrbar und trägt dazu bei, dass die Sockelbelastung in der Sozialhilfe stetig steigt.
Arbeitsintegration: Anspruch und Wirklichkeit
Was liegt da näher, als arbeitslose Menschen mit verschiedenen Massnahmen zu unterstützen, wieder eine Erwerbsarbeit zu finden? Mit diesem Ziel baute die Arbeitslosenversicherung (ALV) in den 1990er Jahren die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren, RAV, stark aus. Auch die Sozialhilfe handelt ähnlich: Die Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe, SKOS, erklären die berufliche Integration zur Kernaufgabe. Schliesslich machte auch die Invalidenversicherung (IV) "Integration vor Rente" zur verbindlichen Vorgabe.
Der einleuchtende Grundsatz, die berufliche Integration zu forcieren, führte zur Konkurrenz um Arbeitsplätze unter den Sozialwerken ALV, IV und Sozialhilfe. Die Bemühungen, die so genannte Interinstitutionelle Zusammenarbeit zu verbessern, genügen bei weitem nicht. Zudem ist die vorwiegend kommunal finanzierte Sozialhilfe mit geringeren Ressourcen ausgerüstet als die Sozialversicherungen. Und alle Integrationsbemühungen können die gesuchten Stellen, die nur in geringer Zahl - und immer weniger - existieren, nicht herbeizaubern.
Mehrere Gesetzesrevisionen erschwerten zudem den Zugang zu Leistungen von ALV und IV. Ich erinnere nur an die Verkürzung der Bezugsdauer bei der ALV, die 2003 wirksam wurde - zeitlich etwas verzögert auch mit steigenden Fallzahlen in der Sozialhilfe. Oder an die erhöhten Hürden für eine IV-Rente. Und noch mehr Leistungsabbau beziehungsweise erschwerte Anspruchsbedingungen stehen bevor: Die hängige Revision der ALV, die eine Sanierung der Kasse auch auf Kosten von Leistungen anstrebt. Und die 6. IV-Revision, die unter dem Titel "Integration aus Rente" steht, was die Konkurrenz um die wenigen geeigneten Stellen verstärken wird.
Nicht für alle, die keinen Anspruch auf Leistungen der IV oder ALV (mehr) haben, muss schliesslich die Sozialhilfe in die Lücke springen, aber für viele. Und manche, die zuerst ihr finanzielles Polster aufbrauchen, sind schon eine gewisse Zeit weg von der Erwerbsarbeit, wenn sie zur Sozialhilfe kommen - bei ihnen können sich inzwischen soziale und gesundheitliche Probleme kumuliert haben.
Der Trend ist eindeutig: Die Sozialhilfe wurde und wird immer mehr zum Auffangbecken für Menschen, die der Arbeitsmarkt nicht aufnehmen kann.
Was für Schlüsse sind aus diesen Entwicklungen zu ziehen?
![]() Der Anspruch auf berufliche Integration aller ist der Realität des
Arbeitsmarktes anzupassen: Nicht alle, die arbeiten wollen und können,
finden eine Stelle.
Der Anspruch auf berufliche Integration aller ist der Realität des
Arbeitsmarktes anzupassen: Nicht alle, die arbeiten wollen und können,
finden eine Stelle.
![]() Die mangelhafte Koordination unter den verschiedenen Trägern der sozialen
Sicherung - ALV, IV und Sozialhilfe - ist insbesondere im Bereich der Arbeitsintegration
schnell und wirksam zu verbessern. Vorschläge, wie dies gemacht werden
kann, sind auf dem Tisch, zum Beispiel die gemeinsame Eingangspforte.
Die mangelhafte Koordination unter den verschiedenen Trägern der sozialen
Sicherung - ALV, IV und Sozialhilfe - ist insbesondere im Bereich der Arbeitsintegration
schnell und wirksam zu verbessern. Vorschläge, wie dies gemacht werden
kann, sind auf dem Tisch, zum Beispiel die gemeinsame Eingangspforte.
![]() Künftige Revisionen der einzelnen Sozialversicherungszweige müssen
auch mögliche Konsequenzen für die Sozialhilfe berücksichtigen.
Künftige Revisionen der einzelnen Sozialversicherungszweige müssen
auch mögliche Konsequenzen für die Sozialhilfe berücksichtigen.
![]() Wer über Jahre keine regelmässige Arbeit hat, dem fehlen oft
die sozialen Kontakte. Dann droht auch die soziale Desintegration. Deshalb
ist die soziale Integration als eigenständiges Ziel aufzuwerten und
nicht nur als Vorbereitung auf eine spätere Erwerbsarbeit zu verstehen.
Wer über Jahre keine regelmässige Arbeit hat, dem fehlen oft
die sozialen Kontakte. Dann droht auch die soziale Desintegration. Deshalb
ist die soziale Integration als eigenständiges Ziel aufzuwerten und
nicht nur als Vorbereitung auf eine spätere Erwerbsarbeit zu verstehen.
Prävention von Armut
Ich habe mich hier vor allem zu den Zusammenhängen zwischen Sozialhilfe und Arbeitsmarkt einerseits sowie zu den Wechselwirkungen zwischen den Sozialversicherungen und der Sozialhilfe geäussert. Die Städte ziehen aus den vergangenen Jahren aber noch einen andern Schluss: Die Politik muss sich viel stärker darum kümmern, die Armutsrisiken zu verringern. Es ist beschämend, dass gerade Kinder und Jugendliche eine überdurchschnittlich hohe Sozialhilfequote aufweisen.
Armut,
so eine gesicherte Erkenntnis vieler Studien, ist vererbbar. Wie das Risiko,
Armut von einer Generation zur nächsten zu vererben, verringert werden
kann, führt Edith Olibet in ihrem
Referat aus.
| Zusammenfassung und Schluss |
Soziale Sicherung an der Realität ausrichten
Sozialhilfe, ursprünglich für kurzfristige überbrückung individueller Notlagen zuständig, wurde zur viele zur dauernden Stütze. Sie muss strukturelle Risiken abdecken, die auf Lücken im System der Sozialen Sicherung verweisen. Daraus ergeben sich Handlungsfelder, denen sich die Politik der Städte, Kantone und des Bundes widmen müssen:
![]() Der Anspruch auf berufliche Integration aller ist bei der heutigen Realität
des Arbeitsmarktes, der dafür zuwenig Stellen hat, nicht einzulösen.
Deshalb muss die soziale Integration als eigenständiges Ziel aufgewertet
werden.
Der Anspruch auf berufliche Integration aller ist bei der heutigen Realität
des Arbeitsmarktes, der dafür zuwenig Stellen hat, nicht einzulösen.
Deshalb muss die soziale Integration als eigenständiges Ziel aufgewertet
werden.
![]() Die Politik muss vermehrt in Prävention von Armut, mithin in frühe
Förderung, Bildung und Berufsausbildung von sozial benachteiligten
Kindern und Jugendlichen investieren. Ein Anfang ist gemacht: Zum Jahr
der Armut 2010 wird ein Armutsbericht erscheinen, an dem neben Bund, Kantonen
und privaten Organisationen auch die Städteinitiative Sozialpolitik
mitarbeitet. Der Bericht soll anschliessend zu einer Armutsstrategie führen.
Die Politik muss vermehrt in Prävention von Armut, mithin in frühe
Förderung, Bildung und Berufsausbildung von sozial benachteiligten
Kindern und Jugendlichen investieren. Ein Anfang ist gemacht: Zum Jahr
der Armut 2010 wird ein Armutsbericht erscheinen, an dem neben Bund, Kantonen
und privaten Organisationen auch die Städteinitiative Sozialpolitik
mitarbeitet. Der Bericht soll anschliessend zu einer Armutsstrategie führen.
![]() Weil Armut mit Bildungs- und Gesundheitsdefiziten eng verknüpft ist,
müssen die entsprechenden Politikfelder koordiniert handeln: Es geht
um eine Gesamtsicht auf die Ursachen von Armut und um ein thematisch ganzheitliches
Vorgehen.
Weil Armut mit Bildungs- und Gesundheitsdefiziten eng verknüpft ist,
müssen die entsprechenden Politikfelder koordiniert handeln: Es geht
um eine Gesamtsicht auf die Ursachen von Armut und um ein thematisch ganzheitliches
Vorgehen.
Gesamtstrategie oder einzelne Schritte?
Das System der Sozialen Sicherheit hat sich über Jahrzehnte entwickelt und ist mit Dutzenden von isolierten Revisionen einzelner Zweige zu einem wenig kohärenten Flickenteppich geworden. Es ist Zeit, das System in seinen Zusammenhängen zu analysierten und an der heutigen Realität neu auszurichten.
Seit einiger Zeit sind verschiedene Projekte und Vorgehensweisen in der Diskussion:
![]() Eine grundlegende Reform der sozialen Sicherung - ein Projekt mit einem
Zeithorizont von mehr als einem Jahrzehnt, wenn man zum Beispiel eine umfassende
Existenzversicherung anstrebt, die alle Risiken abdeckt.
Eine grundlegende Reform der sozialen Sicherung - ein Projekt mit einem
Zeithorizont von mehr als einem Jahrzehnt, wenn man zum Beispiel eine umfassende
Existenzversicherung anstrebt, die alle Risiken abdeckt.
![]() Ein Bundesrahmengesetz, unter dem man sich freilich noch Unterschiedliches
vorstellt: Soll es für die Sozialhilfe Mindeststandards im Leistungsbereich
und in der Organisation festlegen? Oder auch andere kantonale Sozialleistungen
einbeziehen?
Ein Bundesrahmengesetz, unter dem man sich freilich noch Unterschiedliches
vorstellt: Soll es für die Sozialhilfe Mindeststandards im Leistungsbereich
und in der Organisation festlegen? Oder auch andere kantonale Sozialleistungen
einbeziehen?
![]() Eine bessere Koordination und Steuerung der verschiedenen Träger sozialer
Sicherheit, die ohne oder mit wenig gesetzlichen änderungen kurzfristig
machbar ist. Die Städteinitiative Sozialpolitik ist realistisch und
steht hinter der Forderung nach einem Bundesrahmengesetz, aber auch hinter
kleinen Schritten. Sie plädiert aber klar für eine umfassende
Reform. Gerade weil die Entwicklung einer solche Gesamtstrategie viel Zeit
braucht dauert, muss man jetzt damit anfangen.
Eine bessere Koordination und Steuerung der verschiedenen Träger sozialer
Sicherheit, die ohne oder mit wenig gesetzlichen änderungen kurzfristig
machbar ist. Die Städteinitiative Sozialpolitik ist realistisch und
steht hinter der Forderung nach einem Bundesrahmengesetz, aber auch hinter
kleinen Schritten. Sie plädiert aber klar für eine umfassende
Reform. Gerade weil die Entwicklung einer solche Gesamtstrategie viel Zeit
braucht dauert, muss man jetzt damit anfangen.
Welche Revision auch immer: Die Städte fordern von Bund und Kantonen, dass sie mit ihren grossen Kompetenzen an den Reformprozessen beteiligt sind.
| Quelle: Text Städteinitiative Sozialpolitik, Juli 2009 |
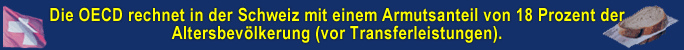 |
| Links |
| Externe Links |
|
| Statistik-eDossier: Eine Orientierungshilfe zum Thema |
| Statistik-eDossier |
|
| Das vorliegende eDossier wurde vom Bundesamt für Statistik Schweiz verfasst und zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt. |
| Das vorliegende eDossier enthält eine Zusammenstellung von statistischen Daten und Analysen zu verschiedenen relevanten Aspekten des Alters. Es soll dazu beitragen, sich vertieft über dieses Thema zu informieren. Aktualisierte Versionen dieses eDossiers werden im Portal Statistik Schweiz: www.statistik.admin.ch für den download publiziert, und zwar auf der Themenhomepage Soziale Sicherheit oder direkter Link: www.socialsecurity-stat.admin.ch). |
 |
|
|
