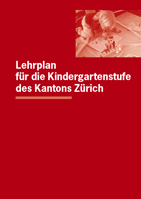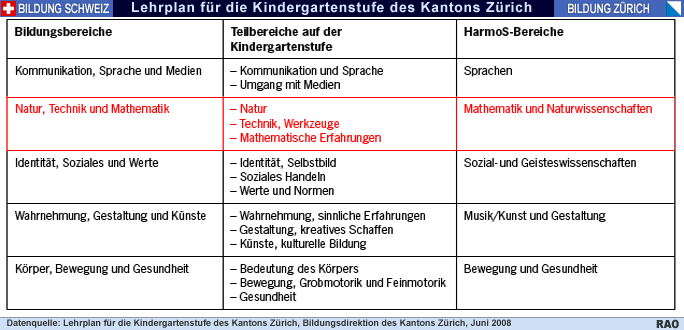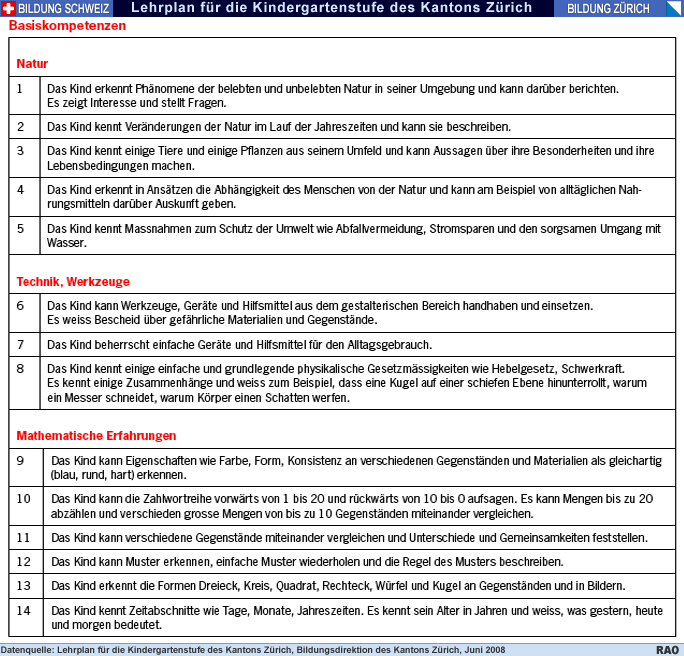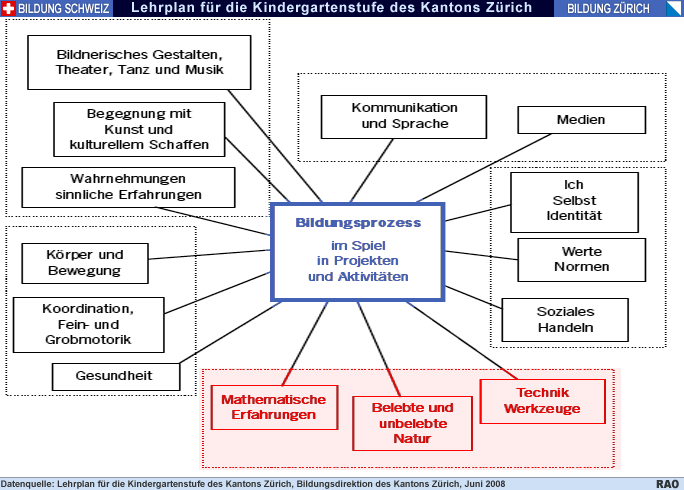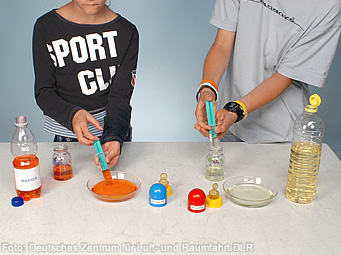| Chemie
- Biologie - Erdwissenschaften - Physik |
| Naturwissenschaften
und Bildung |
 |
Naturwissenschaften Bildung |
|
 |
Naturwissenschaften Bildung |
|
|
Lehrplan
für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich
|
 |
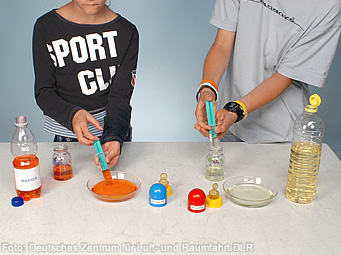 |
| An
seiner Sitzung vom 23. Juni 2008 hat der Bildungsrat den Lehrplan für
die Kindergartenstufe des Kantons Zürich erlassen. Der neue Lehrplan
tritt auf das kommende Schuljahr 2008/09 in Kraft. Die Rückmeldungen
aus der freiwilligen Erprobung konnten weitgehend aufgenommen und im neuen
Lehrplan umgesetzt werden.
Mit
dem Erlass des Lehrplans hat nun auch die Kindergartenstufe - gemäss
Volksschulgesetz die erste Stufe der Volksschule - einen verbindlichen
Lehrplan. Dieser beschreibt als erster Volksschullehrplan der Schweiz die
von den Schülerinnen und Schülern erwarteten Basiskompetenzen. |
|
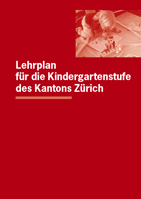 |
| Es
werden darin also nicht nur die Lehr- und Lernziele genannt, sondern es
wird konkret beschrieben, über welches Wissen und Können die
Kinder am Ende der Stufe verfügen sollen.
Im
Zusammenhang mit dem Lehrplan für die Kindergartenstufe wurde insbesondere
die Frage der Unterrichtssprache kontrovers diskutiert. Das Volksschulgesetz
schreibt vor, dass im Kindergarten teilweise Hochdeutsch zu sprechen ist.
Der nun beschlossene Lehrplan gibt den Kindergartenlehrpersonen und den
Schulen einen grosszügigen Spielraum: Mundart wie auch Hochdeutsch
sollen in mindestens einem Drittel der Unterrichtszeit verwendet werden.
In der Umsetzung dieser Bestimmung sind die Lehrpersonen im Rahmen der
Beschlüsse ihrer Schulkonferenz frei. So können die Schulen Erfahrungen
sammeln mit verschiedenen Gewichtungen der beiden Unterrichtssprachen. |
|
nach
oben
| Kanton
Zürich: Lehrplan für die Kindergartenstufe - Natur, Technik und
Mathematik |
 |
nach
oben
| Kanton
Zürich: Lehrplan für die Kindergartenstufe - Natur, Technik und
Mathematik (Auszug) |
 |
 |
| Der
Bildungsbereich Natur, Technik und Mathematik zeigt auf, wie Kinder ein
erstes Verständnis der natürlichen Lebensgrundlagen erwerben
und welche Bedeutung die Meisterung der alltäglichen Verfahren, Techniken
und Materialien hat. Ferner wird aufgezeigt, wie Kinder Verständnis
für mathematische Zusammenhänge erwerben.
Natur
Kinder
haben heute oft wenige Möglichkeiten, Natur zu erleben und kennen
zu lernen. Der Kindergarten ermöglicht solche Erfahrungen. |
|
Zentral
sind dabei reale Naturerlebnisse im Freien, etwa verschiedene Baumarten
draussen im Wald kennen lernen, Tiere beobachten oder einen Garten anlegen.
Bei angeleiteten und freien Aktivitäten entdecken die Kinder natürliche
Lebensräume und deren Bewohner und können dabei auch ökologischen
Zusammenhängen in Ansätzen auf die Spur kommen. Durch wiederholte
Besuche des gleichen Lebensraumes nehmen die Kinder wahr, wie sich dieser
im Lauf der Jahreszeiten verändert. Sie können so genauer und
über einen längeren Zeitraum beobachten, sie können Fragen
stellen und Vermutungen äussern. Sie lernen an konkreten Beispielen,
welche Bedürfnisse bestimmte Pflanzen oder Tiere haben. Sofern artgerechte
Haltung garantiert ist und sich die Gelegenheit ergibt, ermöglicht
die Lehrperson interessierten Kindern, Betreuungsaufgaben zu übernehmen.
Die Kinder erhalten einen Einblick in die Vielfalt der Lebewesen. Sie lernen
durch Beobachten, durch sinnliches Erfassen und Vergleichen von Eigenschaften,
dass es viele verschiedene Lebensformen gibt. Sie schulen ihre Wahrnehmungsfähigkeit
und lernen zunehmend, genauer zu unterscheiden. Der Kindergarten macht
die Kinder auch aufmerksam auf die vielfältigen Formen der unbelebten
Natur wie Erde, Steine, Wasser, Sonne und Wind. Sie erfahren Zusammenhänge
zum Beispiel zwischen Wasser, Dampf, Schnee und Eis. Vielseitige und reale
Zugänge zur belebten und unbelebten Natur sprechen die Kinder sowohl
auf der emotionalen als auch auf der intellektuellen Ebene an.
Die
Abhängigkeit des Menschen von der Natur können Kinder am Beispiel
von ausgewählten Nahrungsmitteln anschaulich kennen lernen. Umgekehrt
beeinflussen wir Menschen durch unsere Aktivitäten die Umwelt. Kinder
können diese Wechselwirkungen zwischen Mensch und Natur nicht in ihrer
ganzen Komplexität erfassen. Sie sollen aber vielfältige Erfahrungen
machen können, um die Natur bewusst wahrzunehmen, selber kennen und
schätzen zu lernen und einen persönlichen Bezug aufzubauen. Damit
soll eine Grundlage zu späterem verantwortungsvollem Handeln gelegt
werden.
Technik,
Werkzeuge
Die
Neugier, das Entdeckenwollen der Kinder richtet sich nicht nur auf Erscheinungen
der belebten und unbelebten Natur, sondern auch auf Phänomene technischer
Art. Kinder sind fasziniert von technischen Anwendungen und Abläufen.
Sie bauen sich Geräte zum Experimentieren mit Luft, Wasser und Geräuschen.
Sie entdecken auf intuitive Weise Gesetze der Hebelwirkung, der Schwerkraft,
des Magnetismus und lernen mit Bau - und Konstruktionsspielen sowie die
Herstellung stabiler Bauten und funktionsfähiger Konstruktionen.
Im
Kindergarten lernen die Kinder den sicheren Umgang mit einer Palette von
Werkzeugen, Geräten, Apparaten und Instrumenten des Alltags. Sie lernen
die Verwendung zahlreicher Hilfsmittel, Materialien und Substanzen, werden
vertraut mit Methoden und Verfahren. Auf diese Weise wird die Basis einer
eigenständigen Handlungsfähigkeit im Alltag geschaffen. Mit dem
Einsatz von Werkzeugen und Geräten lernen die Kinder nicht bloss deren
Bedienung und Handhabung. Sie erfahren gleichzeitig etwas über die
technischen Zusammenhänge, welche ein Werkzeug erst wirksam machen,
warum zum Beispiel ein Messer schneidet, ein Sägeblatt Holz durchtrennen
kann oder ein Hammer viel Kraft ausübt. Gleichzeitig machen sie Erfahrungen
mit der Beschaffenheit der bearbeiteten Materialien und Objekte.
Die
Kultur unserer Gesellschaft ist nicht bloss in den Kunstwerken und Geschichten
vorhanden, sondern auch in den Werkzeugen und Techniken zur Herstellung
von Produkten und Bearbeitung von Material. In ihnen steckt das Wissen
und die Erkenntnis ihrer Erfinder über die Logik der Handhabung, die
Eigenschaften des Materials, die Gesetze der Natur. Werkzeuge und Geräte
sind Dinge, deren Handhabung den Kindern beiläufig und implizit wesentliche
Einsichten vermitteln.
Mathematische
Erfahrungen
Grundlage
des mathematischen Denkens sind Erfahrungen der Kinder über Zusammenhänge
und Abläufe in Natur, Technik und Umwelt. Im Kindergarten erleben
die Kinder, dass es Spass macht, Zusammenhänge und Regelmässigkeiten
zu erkunden und sie in Worte zu fassen. Sie lernen bestimmte Erfahrungen
exakter, treffender und differenzierter zu beschreiben und mitzuteilen,
als dies in der bereits verfügbaren Umgangssprache möglich ist.
Mit dem Erlernen der Bedeutung der Zahlen können genauere Angaben
gemacht werden («vier» Stühle, «sechs» Schritte).
Bereits
beim Eintritt in den Kindergarten hat das Kind ein implizites Wissen über
zahlreiche Zusammenhänge. Im Umgang mit alltäglichen Dingen befasst
sich das Kind im Kindergarten zunehmend mit grundlegenden mathematischen
Themen:
-
das Zählen, die Bedeutung von Zahlen und Zahlzeichen, das Vergleichen
von Mengen, die Unterscheidung von Ganzem und Teilen
-
das Unterscheiden und Vergleichen von Eigenschaften (z.B. Länge, Gewicht,
Farbe, Temperatur), erste Erfahrungen über das Messen und überlegungen
zum Thema Zeit
-
die Erfahrungen über räumliche Eigenschaften, über Position
und Bewegung von Gegenständen im Raum, Erfahrungen über geometrische
Formen, Umgang mit Flächen und Körpern
-
Auseinandersetzung mit Mustern aller Art, mit Regeln der Anordnung und
der Symmetrie
-
erste Erfahrungen mit Addition und Subtraktion in Rollen- und Bewegungsspielen
(«Verkäuferlis», Vorwärts- und Rückwärtsgehen).
Zur
Einführung der Kinder in die mathematische Sprache und das mathematische
Denken sind u.a. zwei Voraussetzungen besonders wichtig: das Wissen über
die Bedeutung von Zahlwörtern und Zahlzeichen und die Fähigkeit,
Eigenschaften von Gegenständen zu vergleichen.
Erfahrung
des Zählens und die Bedeutung von Zahlen
Kinder
haben früh ein Verständnis von Mengen. Sie wissen zum Beispiel,
was viel, was wenig und was mehr ist. Sie können auf einfache Art
Mengen vergleichen. Aber sie wissen in der Regel noch nicht, dass Mengen
durch Zahlen eindeutig definiert werden können.
Ein
erster Schritt dazu ist die Zählfertigkeit: Zahlen - beginnend mit
eins - in einer Reihenfolge aufzusagen und die Zahlensymbole der Reihe
nach anzuordnen. Die Bedeutung des Zählens ist «immer eins mehr»,
«immer eins weiter».
In
einem zweiten Schritt erkennen Kinder, dass Zahlen eine Bedeutung haben.
Auf der Grundlage der Zählfertigkeit gelingt das Abzählen: Den
Gegenständen wird nacheinander eine Zahl zugeordnet und die letzte
Zahl wird als Anzahl, als Menge, bezeichnet. So erschliesst sich dem Kind
die Bedeutung der Zahl: Sie bezeichnet eine bestimmte Menge. Mit diesem
Verständnis kann das Kind nicht bloss «viele» oder «einige»
Teller bringen, sondern zum Beispiel «sechs». Auf diesem Mengen/
ZahlVerständnis bauen die einfachsten Rechenoperationen auf. Sie zeigen
sich in Handlungen des Wegnehmens von der Menge und des Zufügens zur
Menge: Addition und Subtraktion, «Plus» und «Minus»
erhalten ihre Bedeutung.
Vergleichen
als Grundlage von Ordnen und Aufteilen
Das
Abzählen und Erkennen von Mengen beruht auf der Sichtweise, dass Gegenstände
als Ganzheiten wahrgenommen werden: Als Bälle, Autos, Holzstücke,
Würfel, Punkte oder Schrauben. Sie sind auf einfache Weise zählbar,
ihre Mengen sind vergleichbar.
Kinder
lernen jedoch schon sehr früh, Gegenstände auch nach ihren Merkmalen
zu unterscheiden, zum Beispiel nach Formen, Farben, Grösse, Gewicht
und Konsistenz. Es sind zahlreiche Eigenschaften, die das Kind im Kindergarten
über sinnliche Erfahrungen kennen lernt. Es vergleicht Gegenstände
und stellt Gemeinsamkeiten und Unterschiede fest.
Das
Kind lernt, dass viele unterschiedliche Dinge eine bestimmte Eigenschaft
gemeinsam haben: Der Pullover ist rot, der Vorhang, der Farbstift und Blut
sind rot. Auf der Basis dieses Wissens lassen sich Gegenstände klassieren,
in Gruppen ordnen: Es gibt rote, blaue, grüne Farbstifte; salzig,
sauer und süss schmeckende Speisen; die Kleinen und die Grossen; die
Sachen, die weit weg oder nah sind; die Gegenstände, die links oder
rechts liegen.
Eine
weitere Einsicht, die im Kindergarten vertieft wird, ist die Erkenntnis,
dass gleichartige Gegenstände eine Eigenschaft in unterschiedlichem
Ausmass «haben» können. Steine können leicht, ziemlich
schwer oder sehr schwer sein. Wasser kann sehr kalt, kalt, warm, heiss
oder sehr heiss sein, ein Stab sehr kurz, kurz oder lang. Auf der Basis
dieser Unterscheidungen kann das Kind Gegenstände in einer Reihe von
klein nach gross, von leicht nach schwer anordnen, kann Reihenfolgen herstellen.
Solche Wahrnehmungsfähigkeiten, die in alltäglichen und gestalterischen
Handlungen zum Ausdruck kommen, sind eine Grundlage für die Einsicht
in mathematische Zusammenhänge. Die zahlreichen Sortier, Ordnungs-
und Aufteilungsoperationen erfolgen aufgrund einer (oder mehrerer) Eigenschaften
der Gegenstände. Die Kinder können Gegenstände nach verschiedenen
Kriterien klassieren, in Gruppen aufteilen und in Mustern anordnen, indem
sie die Eigenschaften der Gegenstände vergleichen und zueinander in
Beziehung setzen. So entdecken sie Regelmässigkeiten und Zusammenhänge
zwischen den Eigenschaften.
Erfahrung
des Messens und Umgang mit Zeit
Beim
Messen werden die Vorgänge des Vergleichens und Abzählens kombiniert.
Im Kindergarten untersuchen und vergleichen die Kinder zum Beispiel ihre
Körpergrössen, die Länge und Breite des Raumes oder das
Gewicht von Gegenständen. Sie lernen, dass sie die Länge eines
Raumes mit einem Einheitsmass (z.B. Schnur oder Metermass) vergleichen
können. Die neu erworbene Fähigkeit des Zählens kommt ihnen
zustatten, um anderen mitzuteilen, wie viele (abgezählte Menge) «Schnurlängen»
oder «Meter» der Raum lang ist oder wie viele Gewichtssteine
ein grosser Stein schwer ist. Messen erweist sich so als eine Methode,
wie eine bloss individuell erfahrbare qualitative Eigenschaft durch ein
Verfahren mit einem Zahlenwert versehen und so in quantifizierbare und
mitteilbare Form gebracht werden kann.
Auch
die Zeit als Ablauf und Dauer, so lernt das Kind, ist in Zeitabschnitte
unterteilbar und abzählbar. Zeit ist gegliedert und wird einem bestimmten
«Einheitsmass» wie Jahr, Jahreszeit, Monat, Woche, Tag oder
Stunde gemessen. Als Erstes begreift das Kind Tage und Tagesabschnitte,
denn diese Zeitmasse gründen auf eindrückliche Erfahrungen des
Tagesablaufs. Die Erfahrung von zeitlicher Unterteilung erfolgt zugleich
mit deren sprachlicher Benennung: Tag, Abend, Mittag, Nacht, Woche, Frühling,
heute, gestern, morgen.
nach
oben
|
Weiterführende
Informationen
|
 |
 |
 |
Externe
Links |
 |
 |
Externe
Links |
|