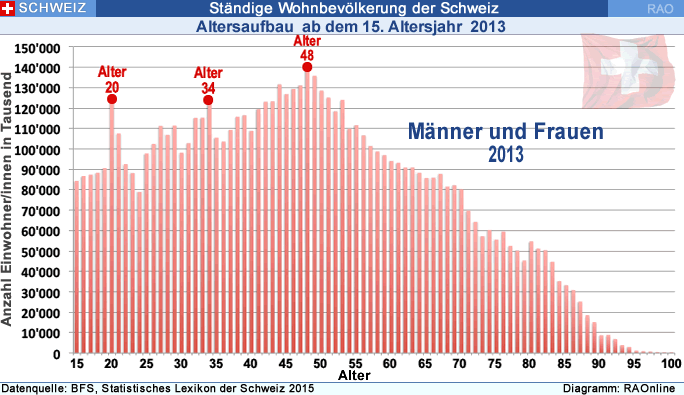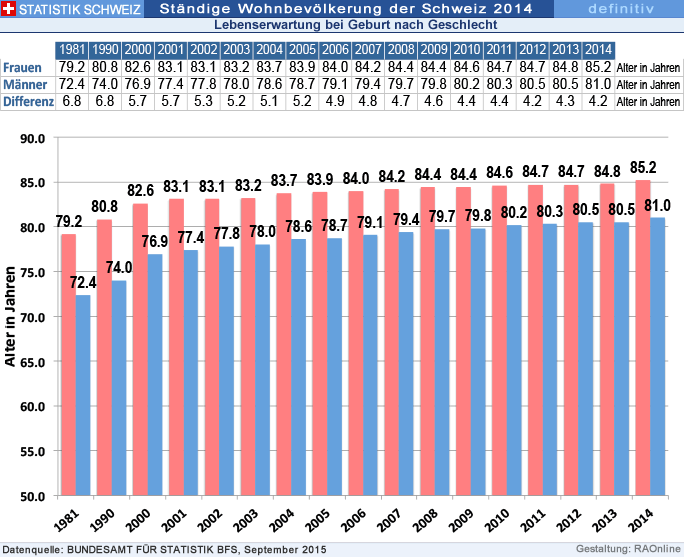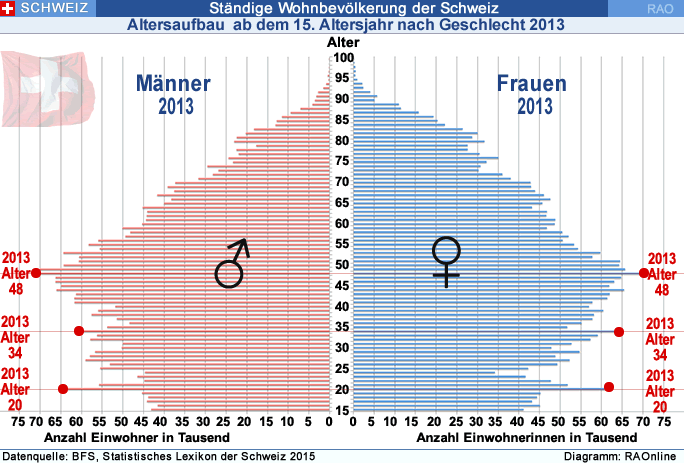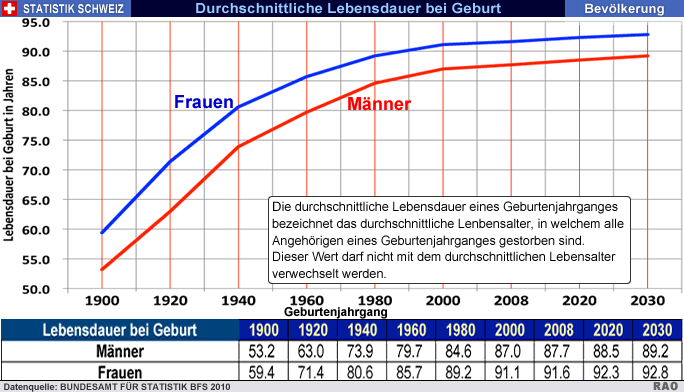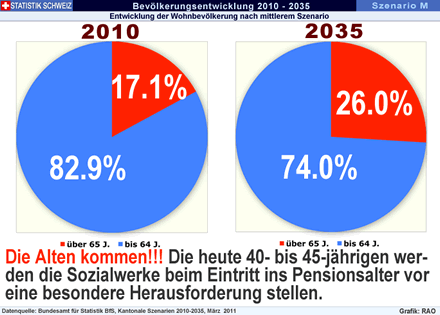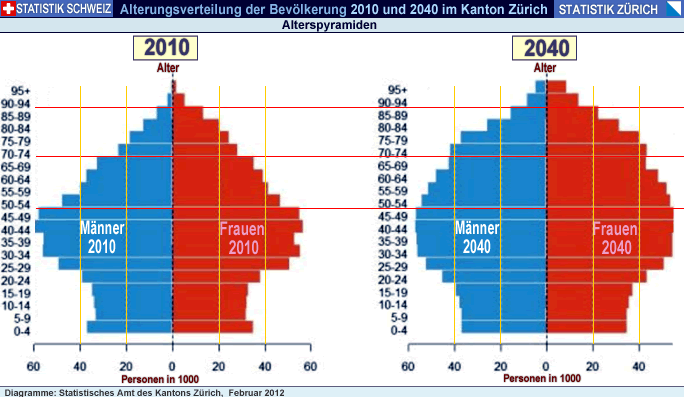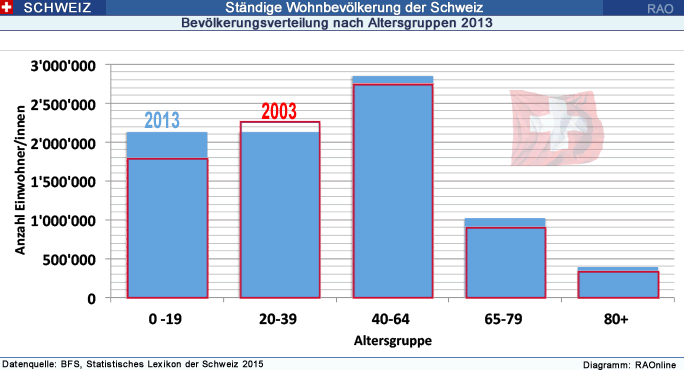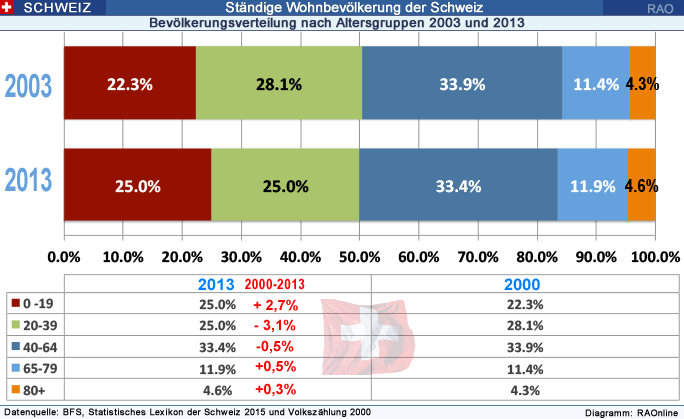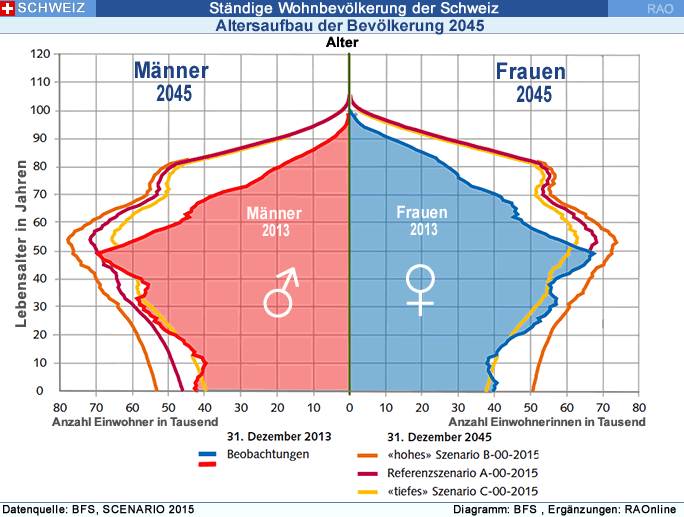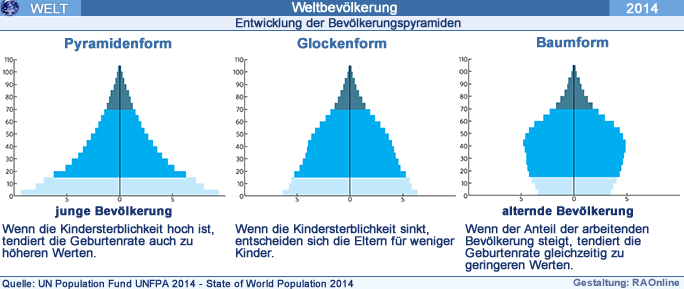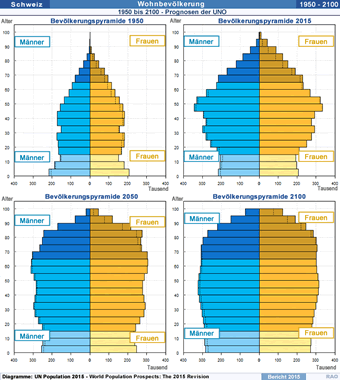|
Statistik
Schweiz: Demographie |
 |
Statistik
Schweiz: Bevölkerung |
|
 |
Statistik
Schweiz: Bevölkerung |
|
|
|
|
Statistik
Schweiz: Demografische Alterung der Schweiz |
Die demografische Strukturen sind im Wandel
Weniger junge, mehr ältere Personen
|
| Die Alterspyramide hat sich im Laufe des 20. Jahrhunderts beträchtlich verändert.
Der Anteil der jungen Personen (unter 20 Jahren) ist von 40,7 Prozent im Jahr 1900 auf 20,9 Prozent im Jahr 2010 gesunken, während derjenige der älteren Menschen (über 64 Jahre) von 5,8 Prozent auf 16,9 Prozent gestiegen ist.
Bei den Betagten (80 Jahre oder mehr) war die Zunahme besonders ausgeprägt (von 0,5% auf 4,7%). Dieses Phänomen der demografischen Alterung ist eine Folge der steigenden Lebenserwartung und vor allem der abnehmenden Geburtenhäufigkeit. Es wird sich im 21. Jahrhundert fortsetzen.
Der Anteil der Personen ab 65 Jahren dürfte von 16,9 Prozent (2010) auf rund 28 Prozent im Jahr 2060 steigen. |
|
Kantonal unterschiedliche Altersstrukturen
Altersmasszahlen zeigen einerseits, dass die Alterung in den Kantonen Tessin, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Schaffhausen und Jura am weitesten fortgeschritten ist. In diesen Regionen kommen über 32 Personen ab 65 Jahren auf 100 Personen im erwerbsfähigen Alter (20-64 Jahre), während es in der Schweiz gesamthaft lediglich 28 Personen sind.
Die höchsten Jugendquotienten andererseits weisen mit über 36 Personen unter 20 Jahren auf 100 Personen im erwerbsfähigen Alter die Kantone Appenzell Innerrhoden, Jura, Freiburg, Neuenburg und Waadt auf.
Zum Vergleich: Die Schweiz zählte 2012 durchschnittlich 33 Kinder und Jugendliche auf 100 Personen im erwerbsfähigen Alter.
Übersichtsanalysen der Volkszählung 2000: Die ältere Bevölkerung
Eine Übersichtsanalysen der Volkszählung 2000 zeigt, dass die ältere Bevölkerung länger lebt, autonomer und gesünder ist. Vermehrt kleine Haushalte, eine verstärkte Wohnsitzmobilität, günstigere Lebensbedingungen und eine bessere Gesundheit sind Merkmale der älteren Bevölkerung in der Schweiz.
Diese Trends weisen auf veränderte Lebens- und Organisationsformen der Personen in der zweiten Lebenshälfte hin, die mit neuen Chancen und Herausforderungen verbunden sind
Die Kantone und Gemeinden der Schweiz sind nicht in gleichem Ausmass von der demografischen Alterung und von den veränderten Generationenverhältnissen betroffen.
Die Bevölkerung ab 50 Jahren ist sehr schnellen Veränderungen unterworfen. Diese lassen sich einerseits dadurch erklären, dass Personen, die in den 1940er- bis 1960er-Jahren geboren wurden und über eine bessere Gesundheit, Ausbildung und finanzielle Situation als ihre Vorgänger verfügen, nun zu dieser Altersgruppe stossen. Andererseits sind sie auf soziofamiliäre Veränderungen zurückzuführen, die in der Schweiz in den vergangenen dreissig Jahren zu beobachten waren. Die Gesellschaft sieht sich angesichts der bevorstehenden beschleunigten demografischen Alterung vor neue Herausforderungen gestellt: Sie muss sich den zunehmenden Ungleichheiten stellen, Lösungen gegen das er höhte Risiko der Einsamkeit finden und sowohl nationale als auch lokale Massnahmen erarbeiten, um das Gleichgewicht zwischen den Generationen zu erhalten.
Szenarien der Bevölkerungsentwicklung der Kantone 2010-2035
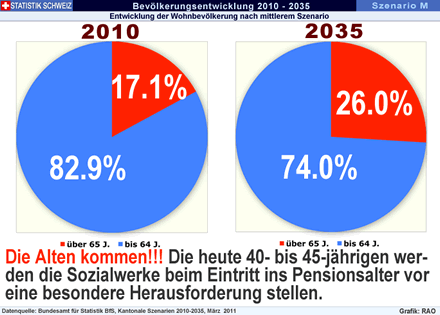 |
| Gemäss den neuen Szenarien des Bundesamtes für Statistik (BFS) zur Bevölkerungsentwicklung in den Schweizer Kantonen werden alle Kantone zwischen 2010 und 2035 ein Bevölkerungswachstum verzeichnen.
Dieses Wachstum, das in erster Linie den internationalen Wanderungen zuzuschreiben ist, dürfte durch die starke Alterung der Bevölkerung in den meisten Kantonen abgeschwächt werden. Allerdings wird die Entwicklung nicht im ganzen Land gleich dynamisch verlaufen. |
|
Altersverteilung im Kanton Zürich
Altersverteilung im Kanton Zürich 2010 - 2040
Verschiedene Masszahlen belegen den derzeit ablaufenden Alterungsprozess. So steigt etwa das Durchschnittsalter der Zürcher Bevölkerung laufend an, bis 2040 wird es um fast vier Jahre auf dannzumal 45 Jahre zulegen. Zudem machen Pensionierte einen immer grösseren Teil der Bevölkerung aus, weil die geburtenstarken Jahrgänge aus der Nachkriegszeit langsam ins Rentenalter kommen. Heute entfallen auf eine Person im Rentenalter vier Personen im erwerbsfähigen Alter, 2040 wird dieses Verhältnis voraussichtlich nur noch 1 zu 2,5 betragen.
Die demografische Alterung ist sowohl eine Folge der niedrigen Geburtenraten als auch der steigenden Lebenserwartung. Dadurch altert die Bevölkerung gewissermassen doppelt, zum einen an der Basis der Alterspyramide, zum anderen auch an deren Spitze. Etwas Gegensteuer vermag die Zuwanderung in den Kanton Zürich zu geben, weil die Zuziehenden eher jung sind. Sie kann die Alterung aber nicht stoppen, selbst dann nicht, wenn deutlich mehr Menschen zuwandern werden als erwartet.
Die demografische Alterung verändert die Bevölkerungszusammensetzung grundlegend und fordert dadurch die Gesellschaft heraus. Ein wichtiges Thema wird etwa die Sicherung der Altersvorsorge sein, ein anderes die Verhinderung des oft zitierten «Pflegenotstands».
Gleichzeitig mit der Alterung wandelt sich aber auch die Bedeutung des letzten Lebensabschnitts. Heutige Menschen leben nicht nur länger als früher, sie haben nach der Pensionierung meist auch noch viele gesunde und aktive Jahre vor sich, ehe sie wegen des Alters schliesslich doch kürzer treten müssen. Dieses Potenzial der Rentnerinnen und Rentner gilt es in irgendeiner Form zu nutzen.
Altersverteilung im Kanton Zürich 1970 - 2050
Die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboom-Generation der 1940er- bis 1960er-Jahre werden in den kommenden Jahrzehnten sukzessive ins Seniorenalter hineinwachsen. Dies bei unverändert niedrigen Geburtenzahlen und bei laufend steigender Lebenserwartung. Damit wird sich die Altersstruktur der Bevölkerung im Kanton Zürich deutlich verändern. Den demografischen Spätfolgen des Babybooms geht eine veröffentlichte Studie des Statistischen Amts nach.
Die als Babyboom bezeichnete Zeit dauerte von 1946 (nach Kriegsende) bis 1964 (Pillenknick). Geburtenstark waren im Kanton Zürich aber die Jahre zwischen 1941 und 1974; in diesen 34 Jahren kamen rund eine halbe Million Babys zur Welt. Die Geburtenraten waren damals deutlich höher als in den paar vorangegangenen und sämtlichen nachfolgenden Jahren. Die Geburtenzahlen waren nicht über die gesamte Zeitdauer gleich hoch.
Alter und Soziale Sicherheit
Die Bevölkerung ab 50 Jahren ist sehr schnellen Veränderungen unterworfen. Diese lassen sich einerseits dadurch erklären, dass Personen, die in den 1940er- bis 1960er-Jahren geboren wurden und über eine bessere Gesundheit, Ausbildung und finanzielle Situation als ihre Vorgänger verfügen, nun zu dieser Altersgruppe stossen. Andererseits sind sie auf soziofamiliäre Veränderungen zurückzuführen, die in der Schweiz in den vergangenen dreissig Jahren zu beobachten waren. Die Gesellschaft sieht sich angesichts der bevorstehenden beschleunigten demografischen Alterung vor neue Herausforderungen gestellt: Sie muss sich den zunehmenden Ungleichheiten stellen, Lösungen gegen das er höhte Risiko der Einsamkeit finden und sowohl nationale als auch lokale Massnahmen erarbeiten, um das Gleichgewicht zwischen den Generationen zu erhalten.
Fortschreitende Alterung der Bevölkerung
Die Alterung der Bevölkerung geht weiter. So ist der Anteil der 65-jährigen und älteren Personen zwischen 2000 und 2007 von 15,4 Prozent auf 16,4 Prozent gestiegen, während im selben Zeitraum ein Rückgang der unter 20-Jährigen (von 23,1% auf 21,5 %) und der 20- bis 39-Jährigen (von 28,9% auf 26,8%) festzustellen ist.
Der Altersquotient (Verhältnis der 65-Jährigen und älteren zu den 20-64-Jährigen) nahm weiterhin leicht zu und lag 2007 bei 26,4 (gegenüber 26,1 im Jahr 2006), während der Jugendquotient (Verhältnis der 0-19-Jährigen zu den 20-64-Jährigen) im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 Punkte auf 34,6 gesunken ist. Der Rückgang der Geburtenhäufigkeit, der Anstieg der Lebenserwartung und das Erreichen des Pensionsalters der umfangreichen Baby-Boom-Generationen sind die Hauptgründe für dieses Phänomen.
| Links |
 |
 |
 |
Externe
Links |
 |
Bundesamt
für Statistik BFS |
|
 |
|